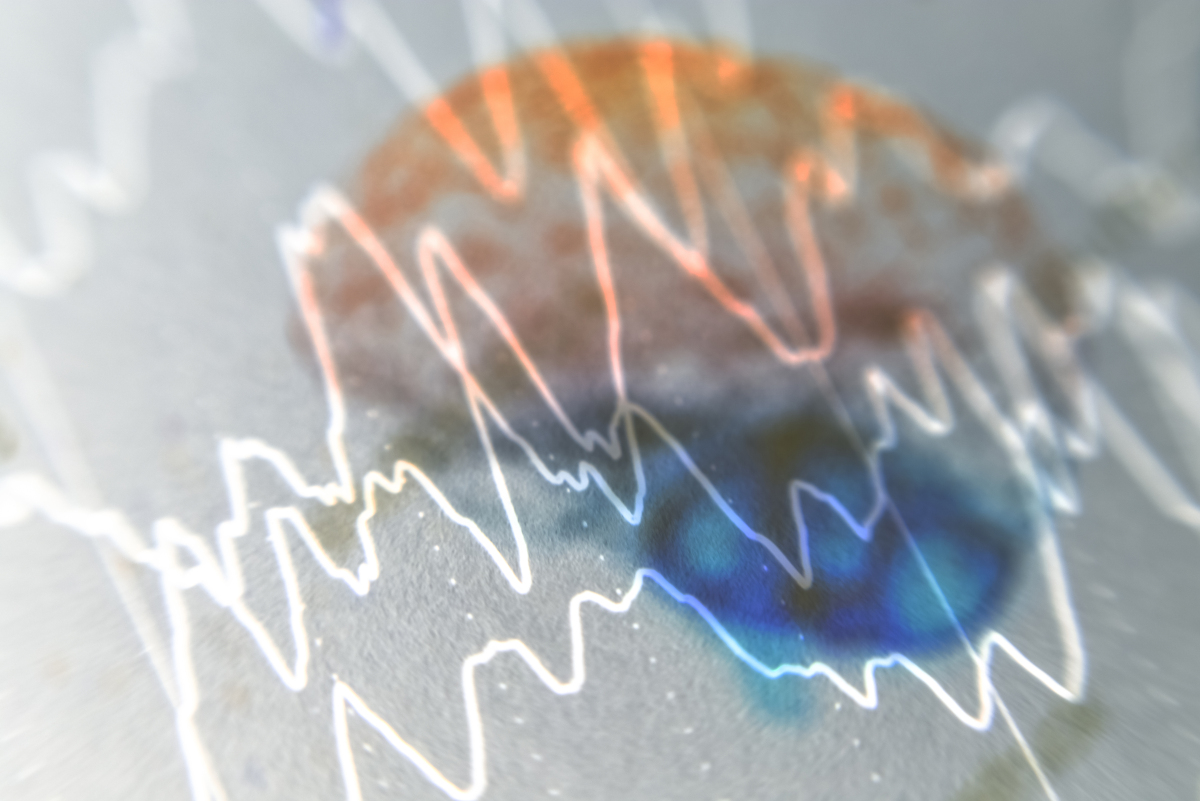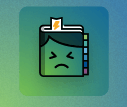Alles andere als gleich: Schmerzwahrnehmung bei Mann und Frau
Wir alle kennen Schmerz. Er ist ein Hilfsmittel, das uns über den Zustand unseres Körpers informiert. Lange glaubte man, dass Männer und Frauen sich in der Wahrnehmung von Schmerz etwa gleichen. Dieses Bild gerät im Licht neuer Forschungen ins Wanken. Es treten immer mehr Unterschiede zutage. Was wissen wir darüber und welche Gründe könnte es dafür geben?
-
Quellenangaben
Bonica JJ. The need of a taxonomy. Pain 1979; 6 (3): 247–248
Dawes JM, Bennett DL. Addressing the gender pain gap. Neuron. 2021 Sep 1;109(17):2641-2642. doi: 10.1016/j.neuron.2021.08.006. PMID: 34473950.
Keogh E, Sex and gender differences in pain: a selective review of biological and psychosocial factors, The Journal of Men's Health & Gender, Volume 3, Issue 3, 2006, Pages 236-243, ISSN 1571-8913, https://doi.org/10.1016/j.jmhg.2006.03.006.
Neumeier MS, Pohl H, Sandor PS, Gut H, Merki-Feld GS, Andrée C. Dealing with Headache: Sex Differences in the Burden of Migraine- and Tension-Type Headache. Brain Sci. 2021 Oct 5;11(10):1323. doi: 10.3390/brainsci11101323. PMID: 34679388; PMCID: PMC8534023.
Pieretti S, Di Giannuario A, Di Giovannandrea R, Marzoli F, Piccaro G, Minosi P, Aloisi AM. Gender differences in pain and its relief. Ann Ist Super Sanita. 2016 Apr-Jun;52(2):184-9. doi: 10.4415/ANN_16_02_09. PMID: 27364392.
Racine M, Solé E, Sánchez-Rodríguez E, Tomé-Pires C, Roy R, Jensen MP, Miró J, Moulin DE, Cane D. An Evaluation of Sex Differences in Patients With Chronic Pain Undergoing an Interdisciplinary Pain Treatment Program. Pain Pract. 2020 Jan;20(1):62-74. doi: 10.1111/papr.12827. Epub 2019 Aug 28. PMID: 31376331.
Racine M, Tousignant-Laflamme Y, Kloda LA, Dion D, Dupuis G, Choinière M. A systematic literature review of 10 years of research on sex/gender and experimental pain perception - part 1: are there really differences between women and men? Pain. 2012 Mar;153(3):602-618. doi: 10.1016/j.pain.2011.11.025. Epub 2011 Dec 20. PMID: 22192712.
Templeton KJ. Sex and Gender Issues in Pain Management. J Bone Joint Surg Am. 2020 May 20;102 Suppl 1:32-35. doi: 10.2106/JBJS.20.00237. PMID: 32251123.